Geschätzt ist aktuell jeder fünfte Inhaber eines Handwerksbetriebs älter als 60 Jahre und beschäftigt sich mit dem Gedanken der Betriebsübergabe. Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) veröffentlichte in seiner neuesten Schätzung, dass im Zeitraum von 2022 bis 2026 in Deutschland insgesamt rund 190.000 Unternehmen einen geeigneten Nachfolger suchen.
Somit hat die Branche nicht nur mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, sondern steht auch bei der Nachfolgeregelung unter Druck. Eine zukunftssichere Betriebsübergabe gelingt allerdings nur, wenn sorgfältige Vorbereitung sie begleitet.
Nachfolge früh planen
Wer als Unternehmer also an den wohlverdienten Ruhestand denkt, sollte rechtzeitig anfangen, die Nachfolge zu planen. Denn in der Regel muss zwischen erster Überlegung und der aktiven Übernahme mit einem Zeitfenster von fünf bis sechs Jahren kalkuliert werden. Die Planung einer Betriebsübergabe ist damit nach der Gründung die wichtigste strategische Phase eines Unternehmens und bedarf einer ebenso intensiven Vorbereitung.
Wer, wenn nicht die eigenen Kinder?
Gerade im Handwerk sind die eigenen Kinder heute oft nicht mehr gewillt, in die Fußstapfen der Eltern zu treten und die Tradition der Familie weiterzuführen. Und selbst wenn, gibt es viele Hürden zu bestehen. Unternehmern, die sich nicht frühzeitig mit der Betriebsübergabe auseinandersetzen, geraten häufig in die Fänge der gesetzlichen Erbfolge und am Ende droht meist die Schließung des Betriebs.
Damit es nicht so weit kommt, sollte ein Fahrplan erstellt werden. Wobei jede Übergabe als Einzelfall zu behandeln ist, damit die Existenz des eigenen Lebensinhalts weiterbestehen kann. Zahlreiche Aspekte spielen dabei eine gravierende Rolle. Die eigene private und familiäre Situation ebenso, wie die betriebliche Bewertung und rechtliche sowie steuerliche Themen.
Weiterführung des Betriebs innerhalb der Familie
Ganz oben auf dem Wunschzettel steht meist die Weiterführung des Betriebs durch den Familiennachwuchs. Doch leider bleibt es, aus unterschiedlichen Gründen, oft beim Wunschgedanken. Aber auch wenn eigene Kinder gewillt sind, das elterliche Unternehmen weiterzuführen, ist dies nicht automatisch ein Erfolgsgarant. Was größtenteils nicht an der Kompetenz der jüngeren Generation liegt.
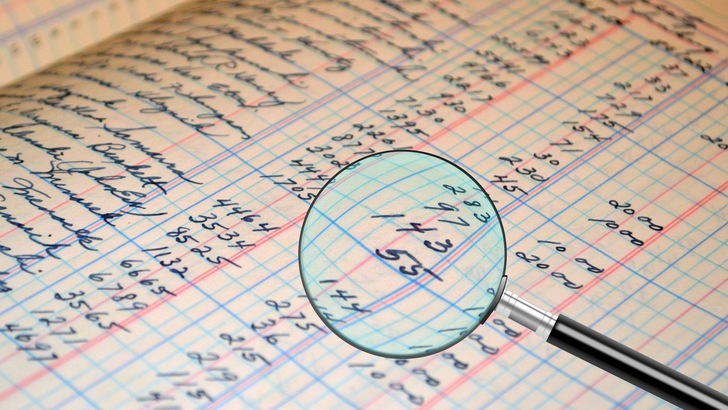
Denn steuerliche und erbschaftsrelevante Belange spielen eine nicht unerhebliche Rolle und sollten im Vorfeld ausreichend geprüft werden. Zudem ist die Aussprache und interne Diskussion im Familienkreis ein entscheidender Punkt, um Differenzen aufgrund von Eitelkeiten und finanziellen Streitigkeiten zu vermeiden.
Auszahlung von Pflichtanteilen berücksichtigen
Selbst wenn der Firmeninhaber dem Nachwuchs frühzeitig ausreichende Weiterbildung ermöglicht und ihm Aufgabenbereiche und Kompetenzen zur Akzeptanzsteigerung im geschäftlichen Umfeld zugesteht, kann dies im Erbfall für den Nachfolger zum großen Problem werden. Zum Beispiel könnte die Forderung zur Auszahlung von Pflichtanteilen die Fortführung finanziell erheblich erschweren.
Sind die Erbrechte nicht im Vorfeld mit allen berechtigten Familienmitgliedern abgesprochen und durch notariellen Erbvertrag geregelt, kann es zu unangenehmen Überraschungen kommen. Die emotionale Komponente ist hierbei nicht zu unterschätzen. Auch eine gesetzliche Erbengemeinschaft mit mehreren Stimmberechtigten findet oft nur schwer zu einvernehmlichen Lösungen, was zur Gefährdung der betrieblichen Existenz führt. Die Bedingungen in Bezug auf die Erbfolge müssen zwingend im Detail geklärt sein.
Als Stiftung weiterführen
Bei Kleinbetrieben, die als Einzelunternehmen oder in einer Personengesellschaft geregelt sind, besteht alternativ die Möglichkeit, die Firma in einer Stiftung weiterzuführen. Auch hier müssen Zuständigkeiten, Befugnisse und Verantwortungen im Vorfeld klar geregelt werden. Die Gründung einer Stiftung kann durchaus steuerliche Vorteile mit sich bringen, daher ist diese Option eine Überprüfung wert.
Vorzeitige Schenkung möglich
Parallel dazu kann die Weiterführung des Betriebs über eine vorzeitige Schenkung realisiert werden. Diese ist wahlweise ohne oder mit Auflagen durchführbar. Ganz ohne Auflagen ist eine Schenkung allerdings nur dann sinnvoll, wenn die eigene Altersversorgung gesichert und die Deckung weiterer Erbansprüche durch einen notariellen Erbvertag geregelt ist.
Im anderen Fall sollte eine Schenkung nur mit Auflagen getätigt werden. Diese können in Form der Einräumung von Nutzungs- und Wohnrechten oder regelmäßigen Versorgungsleistungen, als dauerhafte Leibrente oder als festgelegte Zeitrente, ausformuliert sein. Geleistete Auflagen können zum Ausgleich im Rahmen der späteren Erbfolge angerechnet werden. Allerdings sollte der Nachfolger auch imstande sein zu leisten.
Überlegungen zur Absicherung von unvorhersehbaren gravierenden wirtschaftlichen Veränderungen, wie uns diese die Corona-Pandemie bescherte, müssen vorzeitig mitbedacht werden. Eine Sicherheit könnte eine gemischte Schenkung darstellen, bei welcher laufende finanzielle Mittel fließen, aber gleichzeitig eine Grundschuld auf eine übertragene Immobilie eingetragen wird.
Betriebsübergabe an externe Nachfolger
Sind keine Nachkommen vorhanden, oder lehnen diese eine Betriebsübernahme dankend ab, können auch eigene Mitarbeiter eine Chance auf Weiterführung der Firma sein.

Je eher sie über die Gedanken des Betriebsinhabers informiert sind, umso intensiver können sich die infrage kommenden Beschäftigten Überlegungen über eine eventuelle Übernahme und selbstständige Weiterführung machen. Allerdings, wer hierbei daran denkt, Mitarbeitern das Unternehmen verkaufen zu wollen, scheitert meist. Häufig sind es die finanziellen Mittel der Arbeitnehmer, die den Weg von Wollen und Ausführung kreuzen.
Teilkauf oder Verpachtung
Alternativen könnten der Teilverkauf oder eine Verpachtung sein. Diese Vereinbarungen lassen sich in vielfältiger Weise, wie zum Beispiel über die Ausschüttung von Gewinnbeteiligungen, ausarbeiten. In diesen Fällen ist für den Inhaber ein weiterhin vereinbartes Mitspracherecht gegeben und gleichzeitig ein stufenweises Aussteigen möglich.
Wenn Mitarbeiter die Möglichkeit der Betriebsübernahme nutzen, kann dies von großem Vorteil für die weitere Wirtschaftlichkeit der Firma sein. Der bisherige Arbeitnehmer kennt das Unternehmen im Innen- sowie im Außenverhältnis und besitzt das nötige Fachwissen. Für Kunden und Lieferanten bleibt somit objektiv alles beim Alten. Langjährige Kundenbindungen und das Vertrauen in die Leistungen bleiben bestehen.
Es empfiehlt sich eine frühe Planung
Ein Risiko besteht allerdings in der Gefahr der Betriebsblindheit und damit verbunden eine fehlende Sensibilität für fortschrittliche Verbesserungen. Mögliche Bewerber sollten auch aus Gründen der späteren Akzeptanz gegenüber den ehemaligen Kollegen schon früh ganz genau in Augenschein genommen werden. Abgesehen davon wird die Übergabe an einen Mitarbeiter rechtlich und steuerlich genauso behandelt, wie die Betriebsübergabe durch Beteiligung, Verpachtung oder Verkauf an außenstehende Dritte.

Eine Beteiligung am Unternehmen bietet die beste Möglichkeit einen potenziellen Nachfolger auf schonende Weise, kontrolliert und in Etappen in den Betrieb zu integrieren und sich selbst als Unternehmer Stück für Stück zurückzuziehen. Je nach Firmierung gibt es hier unterschiedliche Beteiligungsmodelle, die sich sowohl für die Nachfolge innerhalb der Familie, als auch für die Übernahme durch Mitarbeiter oder externe Dritte eignen. Je nach Modell gelten gesonderte Haftungs- und Mitspracheregeln.
Vorteile der Verpachtung
Auch die Verpachtung des Handwerksbetriebs kann eine gute Möglichkeit der schrittweisen Übernahme darstellen. Gerade junge Existenzgründer sind oft noch nicht in der gut situierten Lage, den Unternehmenswert durch Kreditwürdigkeit zu berappen.
Hier stellt die Verpachtung mit späterer Kaufoption eine sinnvolle Alternative dar. Dabei kann der bis zum endgültigen Erwerb bezahlte Pachtzins teilweise auf den Kaufpreis angerechnet werden. Die verpachteten Vermögenswerte bleiben bis zur käuflichen Übernahme im Eigentum des Inhabers, der dafür auch weiter das Risiko trägt.
Oftmals werden daher Teilvereinbarungen getroffen, wobei das bewegliche Vermögen, wie Warenbestände, Werkzeuge und der Fuhrpark durch Kauf vom Nachfolger erworben werden und nur die Betriebstätte mit dem Maschinenpark verpachtet wird.
Besonderheiten vertraglich regeln
Beim Verkauf des Unternehmens können ebenfalls detaillierte vertragliche Vereinbarungen die Besonderheiten der Übernahme regeln. Somit ist es durchaus machbar, den Kaufpreis aufzuteilen. Dabei wird ein bestimmter, für den Nachfolger finanziell möglicher, Anteil sofort geleistet und ihm der Rest als Verkaufsdarlehen gewährt. In der Regel werden auch bei dieser Form zunächst Inventar und Warenbestand veräußert und Betriebsräume auf vereinbarte Zeit vermietet.
Eine Veräußerung des Unternehmens auf Ratenbasis sollte besonders abgesichert werden. Durch die Eintragung von Grundschulden, Rentenlasten, Eigentumsvorbehalten oder Sicherungsübereignungen ist das Risiko des Zahlungsausfalls beim Scheitern des Nachfolgers erheblich geringer. Vor allem dann, wenn die Ratenzahlung zur eigenen Altersversorgung dient.
Übernahme durch Einmalzahlung
Die Übernahme durch Einmalzahlung des vereinbarten Kaufpreises stellt für den Veräußerer klar die sicherste Variante der Firmenübergabe dar. Denn hier geht sofort mit Wirksamkeit des Kaufvertrags durch Zahlung, bzw. bei Kapitalgesellschaften durch Übertragung von Anteilen und Grundstücken durch notarielle Eintragung, das komplette Betriebsvermögen an den neuen Eigentümer über. Und damit auch jegliche Verantwortung sowie das komplette Risiko.
Betriebsanalyse und Wertermittlung
Ganz klar ist die kaufmännische, fachliche und soziale Kompetenz des Nachfolgers von bedeutender Wichtigkeit. Damit ein entsprechender Kandidat gefunden wird, muss das Unternehmen angemessen repräsentiert werden. Steht kein Familienmitglied oder Mitarbeiter zur Verfügung, sollte im ersten Schritt das nähere Umfeld geprüft werden. Dazu können Unternehmenskollegen, Lieferanten, ehemalige Mitarbeiter oder auch Geschäftspartner zählen.

Sollte diese Option scheitern, muss das Unternehmen am Markt angeboten werden, um Bewerber anzusprechen. Hierzu eignen sich die Betriebsbörsen der Handwerkskammern. Diese zeichnen sich vor allem durch Wahrung von Anonymität mit der notwendigen Diskretion aus. Alternativ sind Anzeigenschaltungen in Tageszeitungen oder Fachzeitschriften sowie Aushänge in Meisterschulen gute Methoden das eigene Unternehmen zu präsentieren.
Realistischer Wert muss bekannt sein
Doch nur ausschreiben genügt nicht. Zunächst muss der realistische Wert des Unternehmens bekannt sein. Bevor also aktiv an die Nachfolgersuche gegangen wird, sollten Betriebsanalyse und Übergabekonzept ausgearbeitet sein.
Bei der Analyse des Betriebs sind nicht nur die Zahlen und Daten der Vergangenheit wichtig, sondern auch die Bewertung der Zukunft. Vom Erfolg, einen geeigneten Nachfolger zu finden, hängen viele interne und externe Faktoren ab. Je präziser und objektiver die Betriebsanalyse, desto größer die Chancen. Folgende Punkte sollten genau betrachtet und ausgearbeitet werden:
Wertermittlung des Unternehmens
Nach dieser eingehenden Analyse erfolgt die Wertermittlung des Unternehmens. Es ist allerdings nicht einfach, die Basis für spätere Verkaufsverhandlungen zu ermitteln. Die Arbeitsgemeinschaft der wertermittelnden Betriebsberater im Handwerk (AWH) hat als Hilfe einen einheitlichen Bewertungsmaßstab geschaffen.
Das gängige Ertragswertverfahren wurde dabei auf die Verhältnisse von Handwerksunternehmen angepasst. Hierbei kamen zum Beispiel der Einfluss durch die Inhaberpersönlichkeit sowie die finanziellen Aspekte in Bezug auf Privat- und Betriebsvermögen zum Tragen. Somit wurde das AWH-Standardverfahren zu einer realistischen Grundlage bei der Wertermittlung von Unternehmen im Handwerk.
Pachthöhe bzw. Mietbeträge ermitteln
Zur Ermittlung von Pachthöhe bzw. Mietbeträgen gibt es allerdings keine standardisierten Verfahren. Bei der Überlassung von Betriebsräumen liegt meist ein reines Gebrauchsrecht vor, das in einem Mietverhältnis geregelt wird. Mit dem Mietgegenstand dürfen in der Regel keine Erträge erzielt werden. Zur Ermittlung der Miete kann der ortsübliche Mietspiegel für Gewerbeobjekte zu Rate gezogen werden. Dieser regelt sich nach dem Standort der Immobilie sowie dem Zustand der Bausubstanz.
Bei einem Pachtverhältnis handelt es sich um die entgeltliche Überlassung von Betriebsstätten inkl. der Betriebsausstattung. Der Pächter hat dann im Gegensatz zum Mietverhältnis neben dem Gebrauchsrecht auch das Recht mit der überlassenen Ausstattung Erträge zu erzielen.
Bei der Ermittlung der Pachthöhe kommen daher unterschiedliche Verfahren zur Anwendung. Diesen liegen in der Regel gewinn- oder vermögensorientierte Berechnungen zugrunde. Zur Ermittlung werden die Jahresabschlüsse der letzten drei bis fünf Jahre herangezogen sowie die standortrelevanten Mietpreise in Bezug auf Immobilien und Grundstücke.
Weiter fließt ein Betrag für Maschinen, Anlagen und Fuhrpark in die Wertberechnung ein, welcher auch Zinsen und Abschreibungen berücksichtigt. Die errechnete Pacht sollte immer im gesunden Verhältnis zur Ertragssituation stehen, um die Liquidität des Pächters dauerhaft zu gewährleisten.
Fachliche Unterstützung für Absicherung und Durchführung
Zusätzlich zu diesen Überlegungen und Vorbereitungen sind viele weitere vertragliche Dinge zu bedenken. Darunter fällt z. B. die Erhaltung des Firmennamens, die Übergabe von Lizenzen und Patenten oder die Weiterführung von laufenden Verträgen. Daher ist es in jedem Fall ratsam, sich beim Gedanken an eine Betriebsübergabe fachliche Unterstützung an die Seite zu holen.
Wer helfen kann, was bei der betrieblichen und privaten Absicherung zu bedenken ist, wie die Durchführung funktionieren kann und haftungs- sowie steuerrelevante Aspekte werden in Teil 2 des Beitrags dargestellt.
Der Beitrag ist in Ausgabe 4.2022 des TI Magazins (November 2022) erschienen.








