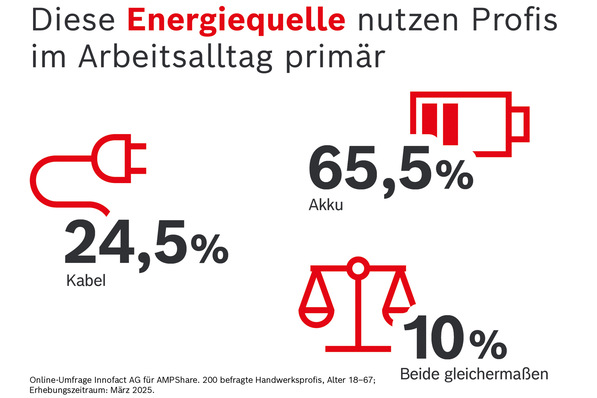Das Gesetz zur Kommunalen Wärmeplanung wiederum verlangt von den Kommunen, Pläne zu erstellen und Szenarien zu entwickeln, wie sie bis spätestens 2045 treibhausgasneutral mit Wärme versorgt werden können. Dazu sind Maßnahmen zu entwickeln. Das Gesetz schreibt außerdem vor, dass bis Ende 2044 sämtliche Wärmenetze ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden müssen. Bis Ende 2026 müssen entsprechende Pläne für den Ausbau der Wärmenetze und die Dekarbonisierung erstellt werden.
Um die Ziele sowohl des Gebäudeenergiegesetzes als auch des Gesetzes zur Kommunalen Wärmeplanung zu erreichen, sind erhebliche Investitionen sowohl in bestehende Gebäude und Anlagen als auch in Neubauten erforderlich. Bei diesem umfangreichen Projekt spielt die technische Isolierung eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer energieeffizienten Wärmeversorgung, sei es für Raumwärme, Warmwasser oder Prozesswärme.
In den darauffolgenden Schritten der Kommunalen Wärmeplanung wird ein Zielszenario entwickelt, das die langfristige Entwicklung der Wärmeversorgung im beplanten Gebiet unter Berücksichtigung der vorherigen Analysen und weiterer Rahmenbedingungen darstellt. Gleichzeitig erfolgt die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete, für die spezifiziert wird, welche Wärmeversorgungsarten in diesen Gebieten geeignet sind und welche nicht. Darüber hinaus werden Gebiete mit einem hohen Potenzial zur Energieeinsparung, beispielsweise durch Sanierungsmaßnahmen, identifiziert. Das Gesamtbild zeigt auf, wie die Gemeinde bis 2045 oder früher eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung realisieren kann.Zum Abschluss erfolgt die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit konkreten Maßnahmen, die geeignet sind, das Ziel einer Wärmeversorgung ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme bis zum gesetzten Zieljahr zu erreichen.
Was die Branche heute bereits unternehmen kann, ist die Identifizierung und Betonung der Potenziale, die die technische Isolierung in den Bereichen Ausbau und Transformation von Wärmenetzen, Umrüstung von Wärmeerzeugungsanlagen, Nutzung von Abwärme sowie Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und industriellen sowie gewerblichen Prozessen bietet. Diese Informationen können den Verfassern von Wärmeplänen dabei helfen, die Potenziale besser einzuschätzen und somit effektivere Maßnahmenpläne zu entwickeln.
Die Schaffung regelmäßiger Kommunikationsmechanismen ist essenziell, um den aktuellen Status der technischen Isolierung im Projekt zu verfolgen und bei sich ändernden Anforderungen entsprechend anzupassen. Darüber hinaus ist die Schulung und Sensibilisierung aller Beteiligten für die Wichtigkeit der technischen Isolierung von großer Bedeutung. Die klare Dokumentation der Isolierungsanforderungen und -maßnahmen gewährleistet, dass die Isolierung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Insgesamt sollte die technische Isolierung als integraler Bestandteil von Investitionsprojekten betrachtet werden, um die Energieeffizienz zu steigern und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
Auf der anderen Seite bieten öffentliche Aufträge die Möglichkeit, in lukrative Projekte einzusteigen und die Geschäftstätigkeit zu erweitern. Die Einhaltung der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen kann die Unternehmensreputation stärken und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Die Abwicklung von öffentlichen Aufträgen erfordert effektives Projektmanagement und bietet die Gelegenheit, Projektmanagementkompetenzen zu entwickeln.
Insgesamt können Unternehmen, die die Herausforderungen bewältigen, von stabilen Einnahmen, einem erweiterten Kundenkreis und einem positiven Image profitieren. Es ist wichtig, die rechtlichen Anforderungen und Vertragsbedingungen sorgfältig zu beachten und eine ausgewogene Strategie zu entwickeln, um die Chancen zu nutzen und die Risiken zu minimieren.
Das Interview führte Petra Frank.