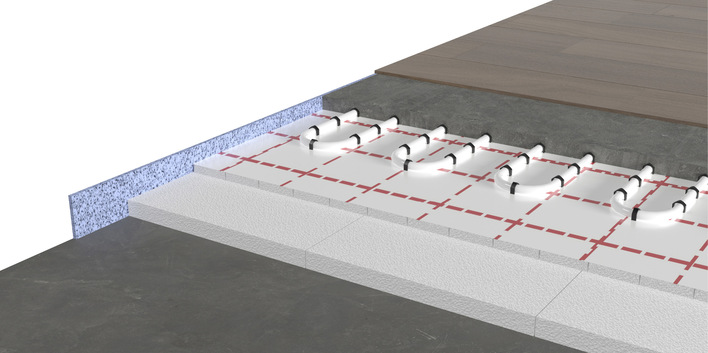Werden Asbestfasern eingeatmet, können sie zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen wie Krebs und Asbestose führen. Seit 1993 ist die Herstellung und Verwendung von Asbest in Deutschland verboten. Aber besonders Isolierungen, Dächer, Bodenbeläge und Rohre älterer Gebäude enthalten oft immer noch asbesthaltige Materialien.
Durch Beschädigungen, etwa während Renovierungs- oder Abrissarbeiten, drohen sie freigesetzt und zur Gefahr für die Arbeiter sowie die Menschen in der Umgebung zu werden. Vor Beginn solcher Arbeiten ist deshalb die gründliche Asbestsanierung vorgeschrieben.
„Gebrauchsanweisung“ TRGS 519
Der Begriff „Asbestsanierung“ umfasst die Identifizierung, Eindämmung, Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Materialien. Die Arbeiten dürfen nur durch speziell geschultes Fachpersonal beziehungsweise unter dessen Anleitung ausgeführt werden. Dabei sind detaillierte Regelwerke einzuhalten, es gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen und es dürfen nur spezielle Geräte und Maschinen zum Einsatz kommen.
Die wichtigsten Gesetze, die die Asbestsanierung in Deutschland regeln
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe „Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten“ (TRGS 519) konkretisieren die Anforderungen der GefStoffV.
„Die TRGS sind sozusagen unsere ,Gebrauchsanweisung‘ für den Umgang mit Asbest“, sagt Wolfgang Kreuch, Leiter der Niederlassung Dinslaken der G+H Isolierung GmbH. Kreuch und sein bundesweit zuständiges Team verfügen über das erforderliche Know-how und jahrelange Erfahrungen in der Asbestsanierung. Die G+H-Experten bieten Auftraggebern einen Rundum-Service an – vom ersten Gutachten bis zur Erfolgskontrolle durch Raumluftmessungen nach der Richtlinie VDI 3492.
Schwach oder fest gebundener Asbest
Zuerst gilt es zu prüfen, an welchen Stellen eines Gebäudes asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Das geschieht durch Augenschein eines Gutachters sowie Untersuchungen von Materialproben im Labor. Wichtig ist bei der Risikobewertung unter anderem, ob es sich um schwach oder stark gebundenen Asbest handelt.
Produkte wie etwa Spritzasbest mit schwach gebundenem Asbest (über 60 Prozent Asbestanteil) sind besonders gefährlich, weil die Fasern leicht freigesetzt werden können. Fest gebundener Asbest hingegen, wie er unter anderem in Asbestzement verwendet wurde, ist weniger gefährlich. Sein Anteil in entsprechenden Produkten beträgt bis zu 15 Prozent.
Wird Asbest festgestellt, erfolgt eine Meldung an die zuständige Behörde, zum Beispiel die Bezirksregierung. Anschließend erstellt der Gutachter ein Leistungsverzeichnis der anstehenden Sanierungsarbeiten. Es enthält unter anderem den Umfang der erforderlichen Arbeiten, führt die benötigten Geräte sowie Materialien auf und legt die Sicherheits- sowie Gesundheitsschutzmaßnahmen fest.
Fasern gelangen nicht in die Umwelt

Bevor die Sanierungsarbeiten beginnen dürfen, schotten die G+H-Fachleute die betroffenen „Schwarzbereiche“ vom übrigen Gebäude ab. Das geschieht mittels Holzrahmen, in die Kunststofffolien gespannt werden. Innerhalb dieser Bereiche stellen lufttechnische Anlagen Unterdruck her.
Deren Abluft wird durch spezielle Filter gereinigt nach außen geführt. Diese Maßnahmen gewährleisten, dass freigesetzte Asbestfasern innerhalb der Schwarzbereiche bleiben und nicht in die Umwelt gelangen.

Die Arbeiter selbst tragen während ihrer Tätigkeiten Ganzkörper-Schutzanzüge sowie Schutzmasken mit Schraubfiltern, Schutzbrillen, Handschutz und Stulpen über den Arbeitsschuhen.
Sie betreten und verlassen ihren Arbeitsplatz durch eine Vierkammerpersonenschleuse, in die eine Dekontaminationsdusche integriert ist. Ihre abgelegte Schutzkleidung wird später zusammen mit den über die Materialschleusen entfernten asbesthaltigen Materialien – dem sogenannten Schwarzmaterial – entsorgt.

Dazu dienen spezielle Behälter wie Säcke, Big Bags und Container: Diese werden versiegelt, damit keine Fasern entweichen können. Anschließend werden sie auf einer geeigneten Deponie für gefährliche Güter entsorgt.
Reinigung und Freigabemessungen
Kommt es während der Arbeiten zu weiteren Asbestfunden, müssen die Fachleute die Situation jedes Mal neu begutachten, bewerten und die Arbeiten neu organisieren. Sind die Arbeiten in einem Bereich beendet, beginnen die Reinigungsarbeiten.

Dafür werden Spezialsauger verwendet, mit denen die verbliebenen Asbestfasern zuverlässig entfernt werden. Abschließend prüfen die Experten, ob die Luft frei von Fasern ist: Messgeräte nehmen acht Stunden lang Luftproben auf, die ein Labor auswertet – die sogenannte Freigabemessung. Werden die Grenzwerte eingehalten, steht der Freigabe eines sanierten Bereichs nichts mehr entgegen: Er kann jetzt ohne persönliche Sanierungs-Schutzausrüstung betreten werden.
Der Artikel ist auch in Ausgabe 2.2023 der Fachzeitschrift TI – Technische Isolierung (Juni 2023) erschienen.