In der Praxis ist eine wasserdampfdiffusionsdichte Ausführung jedoch vor allem an Bauteilen wie Armaturen und Pumpen sehr anspruchsvoll. Daher wird oft ein zusätzlicher Korrosionsschutz für die gedämmten Kühl- und Kaltwasserleitungen notwendig.
Um Antworten auf diese Fragen zu geben hat sich eine Arbeitsgruppe des Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) intensiv mit den anwendungsrelevanten Details des Korrosionsschutzes unter Dämmung auseinandergesetzt und in der jüngst erschienenen BTGA-Regel 3.004 (Abb. 2) zusammengetragen.
Die Grundlagen des Korrosionsschutzes unter Dämmung
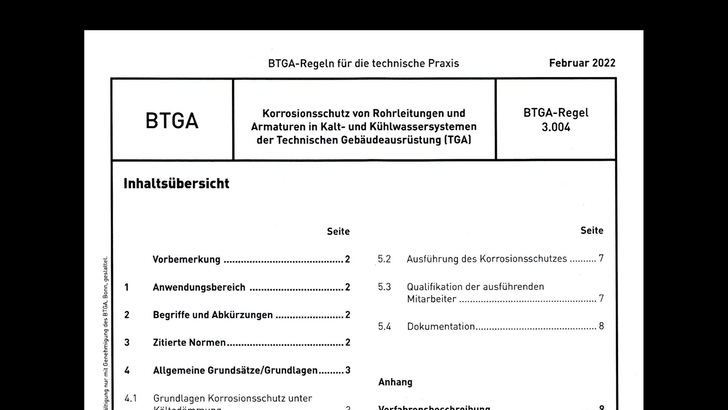
In der DIN EN ISO 12944 1–9 zum Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme sind – aufbauend auf der in Kategorien eingeteilten Korrosivität der Umgebungsbedingungen – verschiedene Beschichtungssysteme für unterschiedliche Anforderungen normiert.
Zur Anwendung kommen Acryl- und Alkydharze, Polyurethan-, Ethylsilikat- und Epoxy-basierte Systeme für Grund- und Deckbeschichtung mit unterschiedlichen Schichtstärken. Diese können nach DIN 4140 prinzipiell auch für den Korrosionsschutz unter Dämmung herangezogen werden – hierfür müssen die Verhältnisse unter der Dämmung jedoch den Korrosivitätskategorien zugeordnet werden (Tabelle 1).
Zusammen mit der geforderten Schutzdauer von mindestens 15–25 Jahren lassen sich dann für verschiedene Werkstoffe die erforderlichen Beschichtungssysteme ermitteln.
Tabelle 1: Zuordnung von Installationssituationen in Abhängigkeit der Rohroberflächentemperaturen und verwendetem Dämmstoff zu Korrosivitätskategorien der DIN EN ISO 12944-2.2018
Diese Auswahl ist in der BTGA-Regel 3.004 nun für Systeme der technischen Gebäudeausrüstung erfolgt: Hier sind passende Beschichtungssysteme zur vereinfachten Anwendung der DIN EN ISO 12944 im Sinne der DIN 4140 in der Praxis in der Tabelle 2 zusammengefasst. Wird der Taupunkt nicht unterschritten oder ist die Dämmung wasserdampfdiffusionsdicht ausgeführt, kann Tauwasserbildung wirksam vermieden werden (Korrosivitätskategorie C1). Nur in diesen Fällen kann von unbedeutender Korrosionsgefahr ausgegangen werden und es reicht z.B. für unlegierten Stahl ein einfacher Korrosionsschutzanstrich von mindestens 60 µm Beschichtungsstärke auf der Basis von Epoxidharz (EP), Polyurethan (PUR) oder Ethylsilikat (ESI) aus. Außenverzinkte Werkstoffe, Edelstahl, Kupfer und natürlich Kunststoffe können dann ohne zusätzlichen Anstrich verwendet werden.
Tabelle 2: Geeignete Beschichtungssysteme für die nachträgliche Beschichtung verschiedener Rohrwerkstoffe für hohe bis sehr hohe Schutzdauern
Bei Taupunktunterschreitung reicht dieser einfache Korrosionsschutz nicht mehr aus. Wenn Tauwasser auf der Rohroberfläche nicht sicher ausgeschlossen werden kann, muss in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit von Chloridaustragungen (Korrosivitätskategorien C2–C4) aus dem Dämmstoff eine aufwendigere Beschichtung gewählt werden (Tabelle 2). Eine galvanische Verzinkung ist dabei als Grundbeschichtung nach EN 12944 verwendbar, wenn diese den Voraussetzungen für das Aufbringen einer Deckbeschichtung (sauber, fettfrei und frei von groben Verunreinigungen, Vorbereitungsgrad St 2 ½) entspricht.
Anwendung in der Praxis
Die Herausforderungen in der Praxis sind letztlich weniger in der Wahl des Beschichtungssystems zu suchen als vielmehr in einer Vielzahl von Detailfragen:
Auch hierzu finden sich in der neuen Handreichung Hinweise. Letztlich ist der ausführende Betrieb für den hergestellten Korrosionsschutz verantwortlich und hat die gelieferten Bauteile mindestens einer stichprobenhaften Überprüfung zu unterziehen. Allerdings ist es Aufgabe der Fachplanung, im Vorfeld die verwendeten Werkstoffe, die erforderliche Beschichtung und auch die Herstellerspezifikationen der zu verbauenden Anlagenteile festzulegen. Im Zweifel ist die Freigabe der jeweiligen Hersteller für den Einsatzzweck einzuholen. Müssen Nachbeschichtungen durchgeführt werden, reicht eine Reinigung der Bauteile von Öl, Fett, Salzen, Schmutz, Staub und ähnlichen Verunreinigungen vor einer Oberflächenbehandlung z.B. mit einer rotierenden Drahtbürste oder anderen Arten von Schleifwerkzeugen aus.
Schweißverbindungen und Übergänge sind ebenso zu reinigen und mit beiderseitigem Überstand von mindestens 5 cm über der werkseitigen Beschichtung zu beschichten. Bei verschraubten Verbindungen sind überschüssige Reste des Dichtmaterials zu entfernen und ggf. freiliegende Gewindegänge analog zu den Rohrleitungen zu beschichten.
Anforderungen an das Fachpersonal
Nicht zuletzt stellt sich die Frage, welche Gewerke mit der Aufbringung des Korrosionsschutzes beauftragt werden können. Die DIN EN 12944 sieht vor, dass die jeweiligen Personen in der Lage sein müssen, die Beschichtung fachgerecht und betriebssicher auszuführen. Zum Nachweis muss unter anderem eine Verfahrensbeschreibung des Beschichtungsvorgangs (Anlage zur BTGA 3.004) vorgelegt werden. Dies setzt in der Regel eine besondere Qualifikation, z.B. entsprechende Anwenderschulungen, mindestens jedoch eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Installationstechnik und einschlägige Berufserfahrung voraus.
Der Artikel ist auch in Ausgabe 1.2023 der Fachzeitschrift TI – Technische Isolierung (Februar 2023) erschienen.





